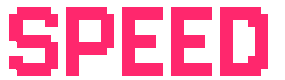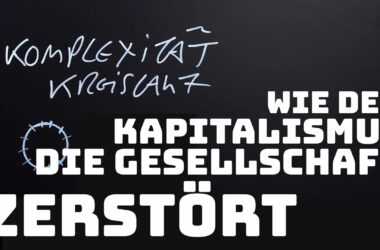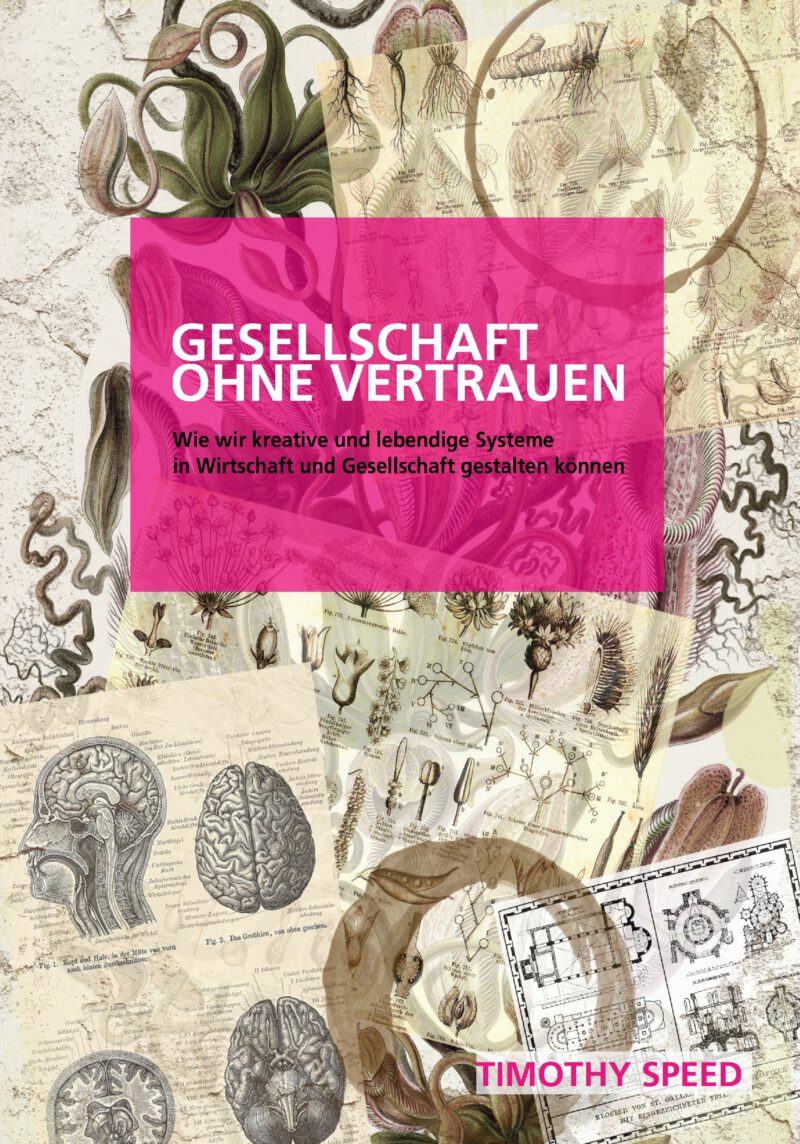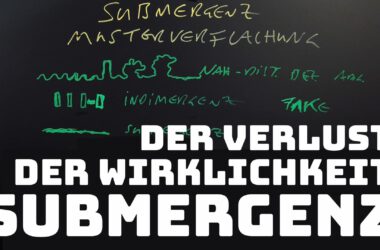In „Gesellschaft ohne Vertrauen“ beschreibt Timothy Speed die innere Ordnung von dynamischen und hoch innovativen Gesellschaften und Systemen.
Die von ihm als „Fixpunkte“ identifizierten Strukturen im Inneren
menschlicher Gestaltungsprozesse führen zu völlig neuen Einblicken in die Art, wie die Evolution durch uns wirkt, den Menschen zu großartigen kreativen Leistungen antreibt und wie jeder Einzelne zum Ganzen beiträgt.
Er zeigt, dass die aktuellen Krisen von Wirtschaft, Kultur, Justiz, Religion und Politik auf natürlichen Zyklen der Evolution beruhen, in denen ein System angesichts neuer Komplexität in einer Gesellschaft zu wenig Freiheit ermöglicht, und darum in die Krise gerät.
Wird die Freiheit aus Angst erneut reduziert, werden die Probleme größer. Wird die Freiheit deutlich erweitert und neu definiert, gelingt es die nächste Stufe der Evolution zu erreichen. Speed beschreibt die zu erwartende neue Stufe, und macht erstaunliche Veränderungen auf allen Ebenen der Gesellschaft sichtbar.
Es zeigt sich eine komplexere Ordnung, die zum einen zu mehr Selbstbestimmung des Einzelnen, zum anderen aber auch zu einem stärkeren „Wir“ führt.
Weitere Rezensionen zum Buch:
Timothy Speeds Buch “Gesellschaft ohne Vertrauen” ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit der Rolle selbstbestimmter, unangepasster und kreativer Individuen in wirtschaftlichen und staatlichen Strukturen. Es entstand vor dem Hintergrund von 9/11 und dem daraus folgenden Vertrauensverlust in der westlichen Welt.
Speed schrieb das Buch, um aufzuzeigen, wie ein übertriebenes Sicherheitsbedürfnis und Angst den Individualismus verdrängen und kreative Potenziale sowie notwendige Bewusstwerdungsprozesse in Krisenzeiten verhindern. Seine Absicht war es, eine Theorie zu entwickeln, die erklärt, wie die Teilhabe vielfältiger, kritischer und unangepasster Menschen in einem System gefördert werden kann und warum dies für die Realitätskompetenz und Entwicklungsfähigkeit einer Gesellschaft entscheidend ist.
Die grundlegenden Thesen und Konzepte des Buches umfassen die Bedeutung von Individualität und subjektiven Impulsen, die bestehende Strukturen auf den Ebenen von Werten, Wissen oder Identität durch neue Perspektiven oder Irritationen destabilisieren, um Entwicklung und echte demokratische Prozesse zu fördern. Speed spricht sich für ein Recht auf Krise aus und fordert ein positives Verständnis von abweichendem Verhalten, um komplexere Ordnungen in der Gesellschaft entstehen zu lassen.
Das Buch ist in mehrere Abschnitte gegliedert, die sich mit verschiedenen Aspekten der Gesellschaft auseinandersetzen. Dazu gehören die Gesellschaft im Inneren, die Rolle der Angst im Schöpfungsprozess, Dissoziation und Differenzierung, die Fantasie des Äthers als dynamisches Weltbild der Wissenschaft, die Schule der Träume und der innere Aufbau des Kosmos als Grundlage der Freiheit. Diese Abschnitte beleuchten, wie eine Gesellschaft gestaltet werden kann, die nicht mehr aus von Privilegierten gesteuerten, politischen Ritualen besteht, sondern in individuellen Prozessen ergründet und diskutiert wird.
Die Konsequenzen und der Ausblick für die Gesellschaft, die Speed in seinem Buch darlegt, sind weitreichend. Er zeigt auf, dass durch die Förderung von Individualität und kreativer Vielfalt nicht nur eine lebendigere und innovativere Wirtschaft entstehen kann, sondern auch eine Gesellschaft, die in der Lage ist, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Speeds Ansätze zielen darauf ab, automatisierte Strukturen, die zu Umweltzerstörungen, Ignoranz oder sozialen Problemen führen, durch bewusstere Formen der Unternehmensführung und gesellschaftlichen Gestaltung zu ersetzen.
Insgesamt ist “Gesellschaft ohne Vertrauen” ein Plädoyer für eine Gesellschaft, die das kreative und systemische Denken fördert und die Vielfalt als Stärke begreift. Es ist ein Aufruf, sich den inneren und subjektiven Prozessen zu öffnen und dadurch eine authentischere und menschlichere Welt zu schaffen.